Obwohl der Pflegesektor in Deutschland immer wichtiger wird, sind Stellen in der Alten- und Krankenpflege so unattraktiv wie eh und je. Geboten werden schließlich nur geringer sozialer Status, schlechter Verdienst und ein vorprogrammierter Burnout. Und die Entwicklung geht in die falsche Richtung.
Durch die lange schwere Krankheit meiner Mutter habe ich Pflege in ganz verschiedenen Situationen beobachtet: im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg, in der Klinik Löwenstein und in häuslicher Pflege. In der Reihenfolge ging es abnehmend hektisch und zunehmend persönlich zu. Über die Qualität der Pflege und die Geduld mit einer Frau, die unter permanenter Atemnot litt, kann ich mich nicht beschweren.
Gleichwohl weiß ich aus Gesprächen mit dem involvierten Personal, dass sie viel mehr Zeit aufwenden mussten, als trotz Pflegestufe III – mit ihren mindestens vier Stunden eingeplanter täglicher Grundpflege – rechnerisch-ökonomisch möglich gewesen wäre, und dass diese Zeit einem Engagement geschuldet war, welches über das Soll oder Muss hinausging.
Nun ist das ja nicht untypisch für diese Branche, denn, sich um Menschen in Not zu bemühen, ist weniger nur ein Beruf. Michelle L. (20) zum Beispiel schließt in Winnenden in den nächsten Monaten ihre Krankenpflegeausbildung ab und möchte nun Kinderkrankenpflegerin werden. Sie möchte das, weil die Pflege einer der Tätigkeitsbereiche ist, in welchen man sich Menschen zuwendet. Sie möchte das, weil die Pflege zugleich derjenige Tätigkeitsbereich ist, in welchem man es mit den hilfebedürftigsten Menschen zu tun hat.
Hinter diesem Einzelfall steckt ein Muster. Man geht nicht wegen der durchschnittlich 2.200 Euro brutto in die Pflege, die man dort im Vergleich zum Bundesdurchschnitt von 3.600 Euro brutto verdienen kann und die nach der Ansicht von Michelle „der Verantwortung, dem Aufwand und der Belastung der Pflegenden“ mitnichten angemessen sind. Man geht hin, weil man helfen will.
Arbeitsbelastung in der Pflege
Nun hat eine umfassende Untersuchung von Daniel Drepper für das Recherchenetzwerkes Correkt!v, welche in den letzten Tagen veröffentlicht wurde, belegt, dass die Situation für Arbeitnehmer (und damit natürlich auch für Patienten) vor allem in der Altenpflege im Argen liegt. Das Schlimmste in Kürze:
- Die Personaldecke ist zu dünn.
- Das Zeitkontingent pro Patient ist für die notwendige Pflege nicht hinreichend.
- Pflegekräfte haben einen sehr hohen Krankenstand.
- Infolgedessen mehren sich Überstunden und Zusatzschichten.
Die daraus resultierende Überlastung erhöht dann wieder die Wahrscheinlichkeit, dass die Arbeitnehmer krank werden – ein Teufelskreis, der sich weiterdreht bis zum „Burnout mit Ansage“, wie Drepper es ausdrückt.
‚Ausbrennen kann nur, wer einmal für etwas gebrannt hat’, lautet ein Allgemeinplatz zum Thema Burnout. Aber das ist hier gar nicht nötig: Wer es mit Menschen in Not zu tun hat, kann diese ja nicht einfach unversorgt lassen, weil seine Schicht zu Ende ist oder weil das Personal der nachfolgenden Schicht halt krank ist. Das wäre menschenverachtend.
Selbstverachtend ist es im Gegensatz dazu, sich dem als Pflegekraft bedingungslos zu unterwerfen. Aber was will man tun? Als Ver.di einmal das Pflegepersonal – in … ach, ich weiß nicht mehr, war es Löwenstein? – streiken ließ, erzählte meine Mutter, dass die Hilfe, welche sie bekam, unvermindert weiterging. Einziger Unterschied war, dass die Pfleger*innen Buttons mit der Aufschrift „Ich streike!“ trugen.
Die Folge dieser dauernden Überlastung zeigt sich schließlich auch in der Statistik offener Stellen – dann nämlich, wenn die Erschöpften erkennen, dass es so nicht weitergehen kann. Im Schnitt nach 13 Jahren wenden Krankenpfleger ihrem Beruf dem Rücken zu; bei Altenpflegern sind es nur acht Jahre. Zum Ausgleich fehlt es an Fachkräften: Im März kamen, wie Drepper feststellt, in der Altenpflege 12.000 offene Stellen auf 3.500 Arbeitssuchende. In allen Pflegebereichen zusammen standen 2013 in Deutschland laut Statista, dem Online-Portal für Statistik, einer Million Bürgern 129,31 offene Stellen gegenüber.
Lösungen für das Pflegeproblem?
Noch ein Teufelskreis dreht sich da also: Solange nicht mehr junge Leute in die Pflege gehen wollen, wird sich die Situation nicht ändern – und solange sich die Situation nicht ändert, wollen sicherlich auch nicht mehr Junge in diesen Berufszweig. Ohnehin würde es nicht reichen, die offenen Stellen zu besetzen; es müssten auch neue Stellen geschaffen und am besten höher dotiert werden – zwei Maßnahmen, welche an den zur Verfügung stehenden Mitteln scheitern. Hier besteht dringender politischer Handlungsbedarf.
Nun versuchen sich die Schweden dieser Tage an zwei Modellen, von denen eines an demselben Geldproblem krankt, das andere aber nicht:
Wie Viola Diem für Die Zeit berichtet, reduzierte einerseits ein Göteborger Altenheim die Arbeitszeiten seiner Mitarbeiter bei vollem Lohnausgleich auf sechs Stunden, um die Belastung des Einzelnen zu senken. Gescheitert ist das Projekt sowohl an der geringen Messbarkeit seines Erfolges als auch an den hohen zusätzlichen Personalkosten.
Den nämlichen Versuch unternahm andererseits auch das Sahlgrenska-Universitäts-Krankenhaus in der Nähe von Göteborg: Sechsstundenschichten bei vollem Lohnausgleich – jedoch ohne Mittagspause – ermöglichten in den dortigen OPs die Umstellung auf Zweischichtbetrieb. Die höheren Personalkosten wurden durch zusätzliche Operationen finanziert.
Nun ist lediglich eines dieser Modelle für mein Thema von Interesse: Im Sahlgrenska-Krankenhaus war nämlich die Konsequenz aus der Entlastung messbar. So reduzierte sich die Zahl der Kündigungen im Pflegepersonal dramatisch – unter Neueinstellungen sogar um 80 %. Die Arbeitnehmer nicht zu verheizen, verhindert offensichtlich auch dann den Burnout, wenn diese für ihren Job brennen.
Einschränken muss ich natürlich festhalten, dass die Verringerung des Krankenstandes unter den Altenpflegern in den Göteborger Einrichtungen – und deswegen muss auch dieser Versuch erwähnt werden – keine so deutliche Sprache spricht, sondern vielleicht sogar zu vernachlässigen ist: Sie sank während der Phase der Sechsstundenschichten nur um 0,6 %.
Zwei Lehren können aus beiden Modellfällen gezogen werden:
- Die Senkung der Arbeitsbelastung für Pfleger wurde nur dort als erfolgreich angesehen, wo sich die Produktivität steigern ließ und die Kosten somit nicht von außen getragen werden mussten.
- In Deutschland müsste man erst einmal dazu kommen, die Arbeitszeiten auf das tarifvertragliche Maß zu senken.
Stattdessen aber steigt die Zahl der Überstunden. Wie Rainer Woratschka im Tagesspiegel unter Berufung auf das Statistische Bundesamt berichtete, erhöhte sich die Zahl der Pflegebeschäftigen, welche Überstunden machten, von 2011 auf 2013 um 57 Prozent. Die Nutzung weiterer Verrechnungsformen für zusätzliche Arbeitszeit wie Mehrarbeitskonten stieg im gleichen Zeitraum ferner um 24 Prozent.
Horrorszenario Pflegeakkord
Das Problem ist aber, dass sich in der Pflege die Produktivität nicht steigern lässt, es sei denn, man verringert das Pflegeangebot, sprich vernachlässigt den Patienten. Schon 2013 versorgte eine vollzeitbeschäftigte Krankenpfleger*in pro Schicht im Schnitt 59 Patienten statt der 45 im Jahre 1997. Das bedeutet, im Schnitt nur 7,8 Minuten pro Patient haben.
Selbst wenn man hier normalkranke, nicht schwerer pflegebedürftige Patienten zugrunde legt, ist das mehr ein Horrorszenario als ein schlechter Witz, denn in diesen knapp acht Minuten wird ja nicht nur Essen ausgegeben und das Bett bezogen, sondern auch verbunden, versorgt und gegebenenfalls gewaschen. Tatsächlich, meint die von mir befragte Krankenpflegeschülerin Michelle L. (20), dass diese Zeit kaum reiche, „die wichtigsten Dinge zu erledigen, geschweige denn manchmal auch nur fünf Minuten mit dem Patienten zu reden.“
Das Schlimmste zum Schluss: Die von Viola Diem interviewte Arbeitsforscherin Christiane Flüter-Hoffmann vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft spricht davon, dass es in Zukunft generell – also nicht direkt bezogen auf die Pflege – weniger um Arbeitszeiten gehen wird. „Es wird vor allem das Arbeitsergebnis zählen“, wird sie zitiert. Das heißt: Wer früher fertig ist, kann früher gehen.
Man könnte jetzt frotzeln, dass der Sorgfältige dann halt der Dumme sei. Faktisch sind dann aber alle Arbeitnehmer die Dummen, denn diese Form des Arbeitsmodells führt dazu, dass das unternehmerische Risiko des (Zeit-)Aufwandes allein von den Arbeitnehmern getragen wird. Entweder sie machen es auf eigene Kosten gründlich, oder sie folgen dem Anreiz zum Schlampern.
Nur dass beides für Pflegekräfte keine Option sein kann. Und obwohl ich leidenschaftlich gerne sagen würde „Ergreift einen Job in der Pflege, denn da brauchen wir Euch und Ihr leistet wichtige Arbeit“, kann ich deshalb hier nur herumdrucksen: „Lasst lieber die Finger davon.“
Zum Glück kann ich da aber Michelle das Schlusswort überlassen, denn sie „mag ihren Beruf einfach“. Trotz all der negativen Nachrichten bezüglich Überlastung, Stresskrankheiten und Berufswechseln brennt sie weiter für die Pflege und sagt: „Ich lasse das jetzt erst einmal alles auf mich zukommen und werde sehen, wie sich die Zukunft entwickelt. Es ist trotz allem ein toller Beruf. Jeder sollte sich einfach mal selbst davon überzeugen und wird das dann auch erkennen.“
Verwendetes Bild: © 2011 abbamouse.




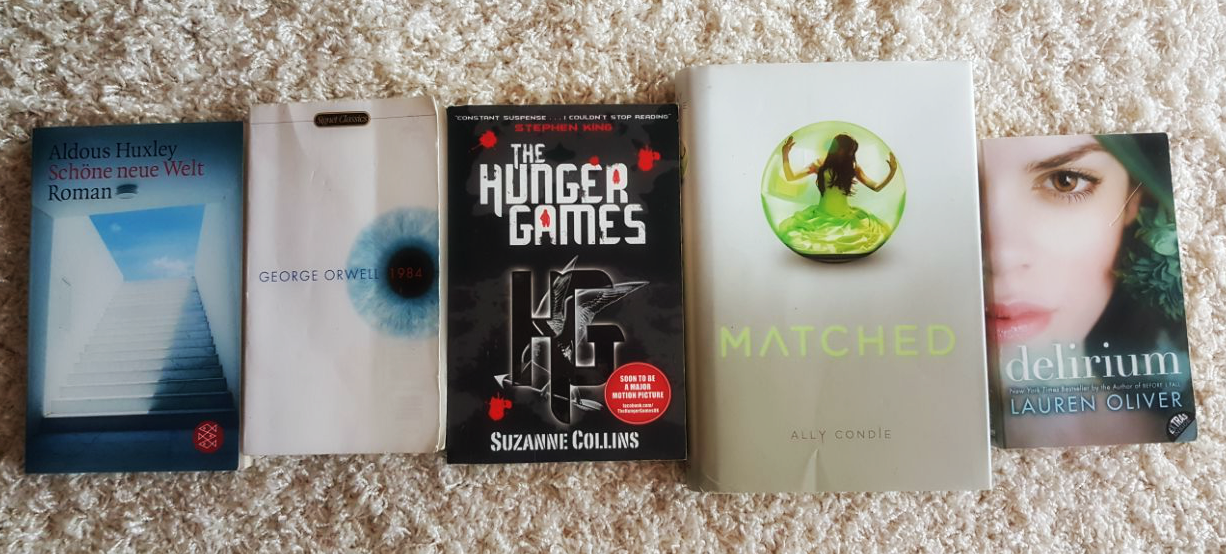
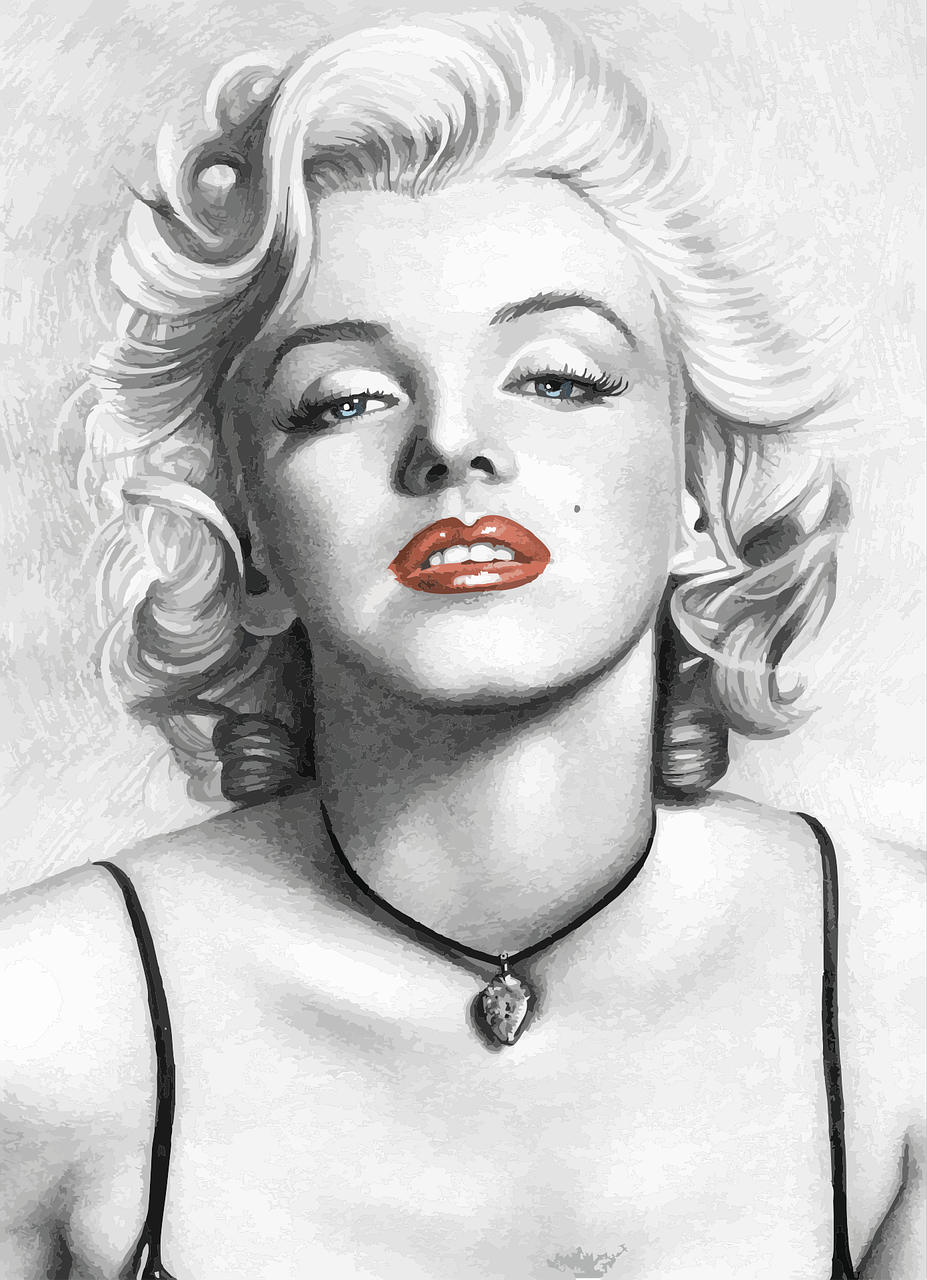







Ein Kommentar