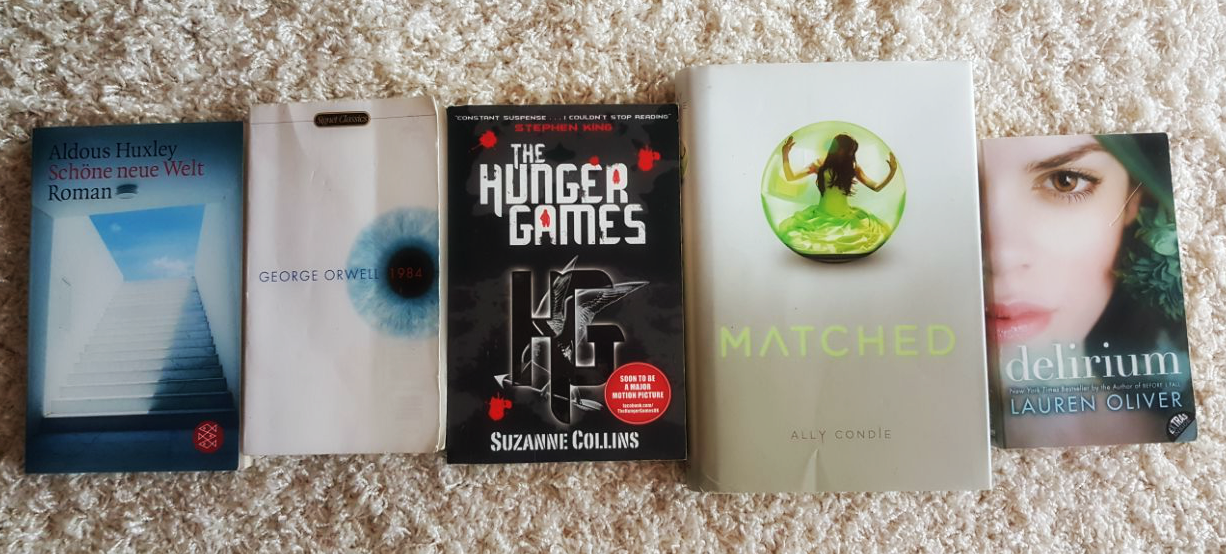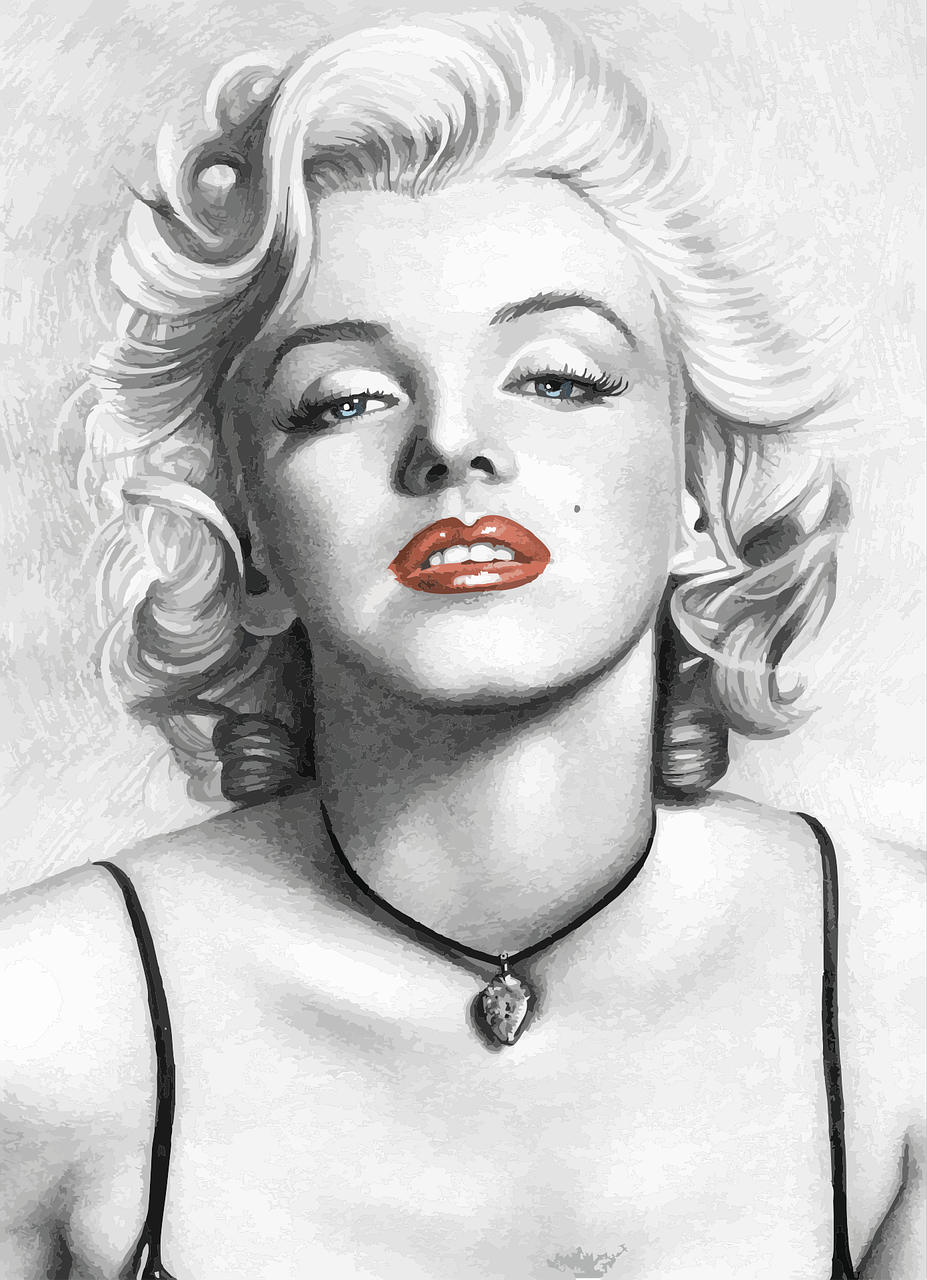Wer kennt nicht die Berichte über die Wohnungsnot in den Städten oder über Mietpreisbremsen? Viel wird darüber diskutiert und eine Lösung scheint der Bau von Sozialwohnungen zu sein. Doch was sind Sozialwohnungen überhaupt und wie sind sie entstanden? Hier erfolgt eine Bestandsaufnahme.
Heruntergekommene Hochhäuser. Müll auf den Straßen. Eine Wohngegend, in der niemand leben will. An solche oder ähnliche Bilder denken vielen Menschen bei dem Thema „Sozialer Wohnungsbau“. Auch mir kommen zuerst in den Sinn die Bilder von den Plattenbauten, in welchen meine Oma wohnt. Haus an Haus, Wohnung an Wohnung reihen sie sich und sind schon weit von der Straße her erkennbar. Die Flure sind dunkel, die Treppengeländer alt. Die Wohnung selbst hat nur drei Zimmer. Ein Bad ohne Fenster und mit Loch unten in der Tür. Alles ist hellhörig. Ich bekomme um drei Uhr nachts mit, wenn die Nachbar*innen im Haus einen Streit haben oder sich, ebenso lautstark, wieder vertragen.
Damit scheint unser Bild von Sozialwohnungen und auch von dem sozialen Wohnungsbau vorgeprägt zu sein. Aber was steckt hinter diesem Begriff und wie ist der soziale Wohnungsbau überhaupt entstanden?
Jeder hat ein Recht auf Wohnen
Der soziale Wohnungsbau ist fest mit dem Recht auf Wohnen verbunden. Dieses Recht ist ein Menschenrecht der zweiten Generation. Menschenrechte der zweiten Generation vereinen wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, die von Staat in Form von positiven Leistungen, wie beispielweise soziale Sicherheit, gewährleistet werden. Zu diesen Rechten gehört auch das Recht auf Sicherheit, auf bezahlte Arbeit oder auf Bildung und Ausbildung.
Der Artikel 11 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte besagt nun, dass jeder Mensch das Recht auf einen angemessenen Wohnraum hat. Der Grundgedanke dieses Gesetzes entstand in Deutschland schon im Jahr 1919 in der Weimarer Republik. Auch die Verfassung der DDR verankerte das Recht auf Wohnen, doch Sozialwohnungen sind noch älter.
Die ersten Sozialwohnungen
Als erste und vielleicht auch bekannteste westliche Sozialsiedlung der Welt lässt sich die Fuggerei in Augsburg nennen. Das ist eine Reihenhaussiedlung, die Jakob Fugger – bezeichnend auch „der Reiche“ genannt – im Jahr 1521 der Stadt Augsburg stiftete. Damals bestand die Fuggerei aus 52 Wohnungen, die in sechs Gassen standen. Für die damalige Zeit war der Wohnraum in den zweigeschossigen Häusern großzügig geplant. Vor allem arme Handwerker und Tagelöhner, die aus eigener Kraft, weil sie beispielsweise krank waren, keinen Haushalt führen konnten, durften dort leben.
Jakob Fuggers Ansicht, dass er mit den Wohnungen Hilfe zur Selbsthilfe für diese Bevölkerungsschicht bieten wollte, war revolutionär, denn davor kümmerte man sich nicht um Menschen, die sich selbst nicht versorgen konnten. Auch heute wird dieser Gedanke in der Fuggerei noch fortgeführt. In 140 Wohnungen, die sich auf 67 Häuser verteilen, dürfen 150 bedürftige katholische Augsburger Bürger*innen bei einer Jahresmiete von 0,88 Euro wohnen. Dafür müssen sie täglich einmal das Vaterunser, ein Glaubensbekenntnis und ein “Ave Maria” für die Stifterfamilie ablegen.
Die Fuggerei hat also den Anfang für den sozialen Wohnungsbau gemacht, heute erfüllt sie ihre Pflicht jedoch nicht mehr, weil sie nur einem kleinen Teil der Bevölkerung Wohnraum bietet – dem katholischen Teil.
Der Aufschwung des sozialen Wohnungsbaus
Immer mehr Sozialwohnungen entstanden in den 1920er-Jahren, da zu dieser Zeit in vielen deutschen Städten neue Siedlungen entstanden. Man wollte die Arbeiterviertel, die in der Kaiserzeit eher Armutsviertel mit akuter Wohnungsnot waren, auflösen und den Menschen nach diversen Mietstreits und Krawallen Wohnraum bieten und somit die Bevölkerung beruhigen. Eine bekannte Siedlung, die damals entstand, war die Hufeisensiedlung in Berlin im Stadtteil Britz. Diese Siedlung ist heute übrigens Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, da sie ein Paradebeispiel für Siedlungen der Berliner Moderne darstellt. Besonders ist bei der Hufeisensiedlung, dass sie nicht nur nach dem namengebenden Hufeisen angeordnet ist, sondern es viele Grünflächen dazwischen gibt. Man wollte eine idyllisch-dörfliche Atmosphäre mit ziegelgedeckten Giebeldächern und Sprossenfenstern schaffen.
Während des Nationalsozialismus erlebte der soziale Wohnungsbau einen Einriss, denn man wandte sich von den großen Miethausprojekten ab, die während der Weimarer Republik dominierten. Stattdessen wurde sich – auch wegen Geldmangels – der nationalsozialistischen Wohnungsideologie untergeordnet, welche besagte, dass keine „Massenquartiere“ gebaut werden sollten. Das Kleinfamilienhaus rückte in den Mittelpunkt. Es wurden von Robert Ley, dem Leiter der Deutschen Arbeitsfront (DAF), schon Pläne gemacht, wie die Deutschen nach dem Krieg leben sollten. Seit 1940 wurden sogar schon Grundrisstypen erstellt und Städte geplant, bis die Bombenangriffe diese Pläne stoppten.
Die Wohnungsnot ging weiter
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren allein in Westdeutschland über 2,34 Millionen Wohnungen zerstört, was ungefähr ein Fünftel des Wohnungsbestandes ausmachte. Dazu kamen die Heimatvertriebenen, die auch Wohnungen suchten, sodass Anfang der fünfziger Jahre mehr als 6,5 Millionen Wohnungen gebraucht wurden. Deshalb entstanden immer mehr Vereine und Arbeitsgemeinschaften, die Wohnungen schafften. Als Beispiel können dafür die Grünhöfe in Bremerhaven gesehen werden. Es wurde versucht sowohl Miets- als auch Genossenschaftswohnungen zu bauen, wobei ab den 1970er-Jahre viele Neubaugebiete auf der grünen Wiese entstanden, die heute das Stadtbild vieler Orte prägen.
In der DDR führte der soziale Wohnungsbau zu den bekannten Plattenbauten in den Neubaugebieten und der Vernachlässigung der Altstädte, deren Kriegsschäden oft erst nach der Wiedervereinigung restauriert wurden. Wobei bei den Sozialwohnungen der DDR anzumerken ist, dass nicht jede*r Bürger*in eine Wohnung einfach bekam. Es gab mehrere Voraussetzungen dafür: So bekam ein verheiratetes Paar mit einem Kind eine Zweizimmerwohnung. Ab zwei Kindern wurden einem drei Zimmer zugesprochen und Unverheiratete hatten überhaupt keinen Anspruch auf Wohnraum. Die Wohnungsnot war in der DDR immer noch groß und konnte durch diese Regelungen nicht gut abgefangen werden.
Und heute?
Heute ist die Situation nicht besser. Es fallen immer mehr Wohnungen für Menschen mit geringen Einkommen weg und es werden kaum mehr neue gebaut. Die Zahl der Sozialwohnungen hat sich in den letzten 15 Jahren halbiert, was nicht bedeutet, dass die Bevölkerung diese Wohnungen nicht braucht. Es gibt genug Menschen, die immer noch Wohnungen zu einem relativ günstigen Preis brauchen. Um diese Bedürfnisse abzudecken gibt es die soziale Wohnraumförderung, bei welcher private und kommunale Investoren, die preiswerte Mietwohnungen bauen und diese für benachteiligte Bevölkerungsgruppen zur Verfügung stellen, mit Zuschüssen gefördert werden. Allein im Jahr 2019 wurden für den sozialen Wohnungsbau 2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.
Für die einzelnen Bewohner*innen gibt es das Wohngeld. Dieses gehört seit dem 01. Januar 2005 zu den Transferleistungen, welche auch das Arbeitslosengeld II, die Altersgrundsicherung oder das Bafög beinhalten. Das Wohngeld wird Menschen zugesprochen, die sich aus eigener Kraft keinen Wohnraum leisten können, um auch ihnen Zugang zu Wohnraum mit durchschnittlichen Kosten zu ermöglichen.
Es gibt noch eine Reihe an weiteren Fördermaßnahmen der Bundesregierung, wie die Eigentumsförderung oder Wohnungsbauprämien, die versuchen weniger bemittelten Menschen den Weg zu kostengünstigen Wohnungen zu ebnen. Auch wird in der Politik über Mietpreisbremsen diskutiert. Doch reicht das aus? Schließlich kennen alle die Wohnungsnot – welche vor allem die Not an bezahlbaren Wohnraum bezeichnet – in den Städten und die Landflucht. Es scheint also noch viel Verbesserungsbedarf zu diesem Thema zu geben und die eine richtige Lösung, wenn es die überhaupt gibt, ist noch nicht gefunden.