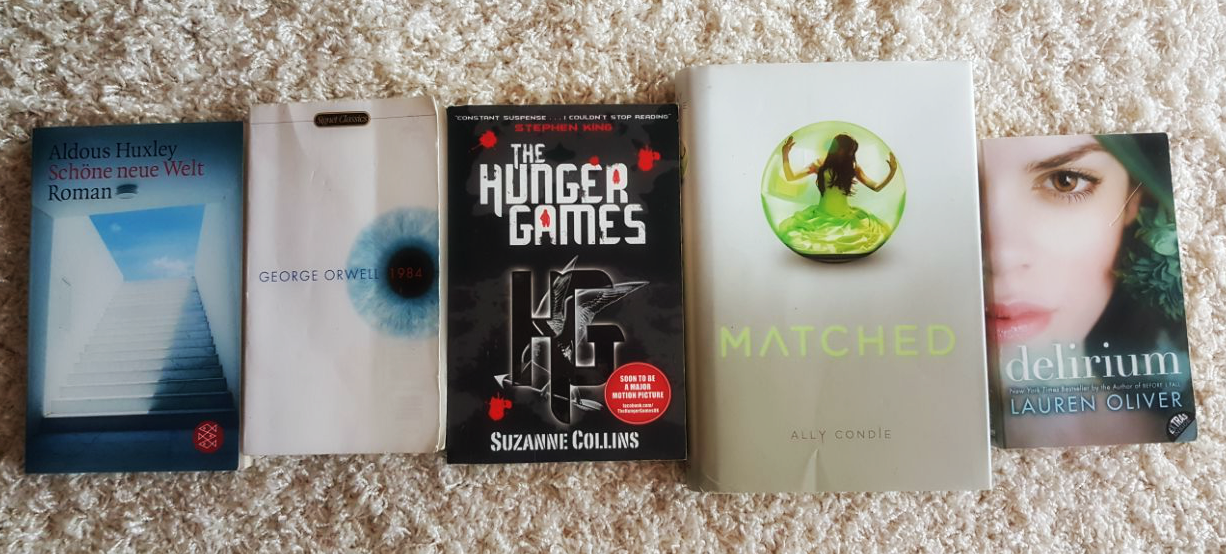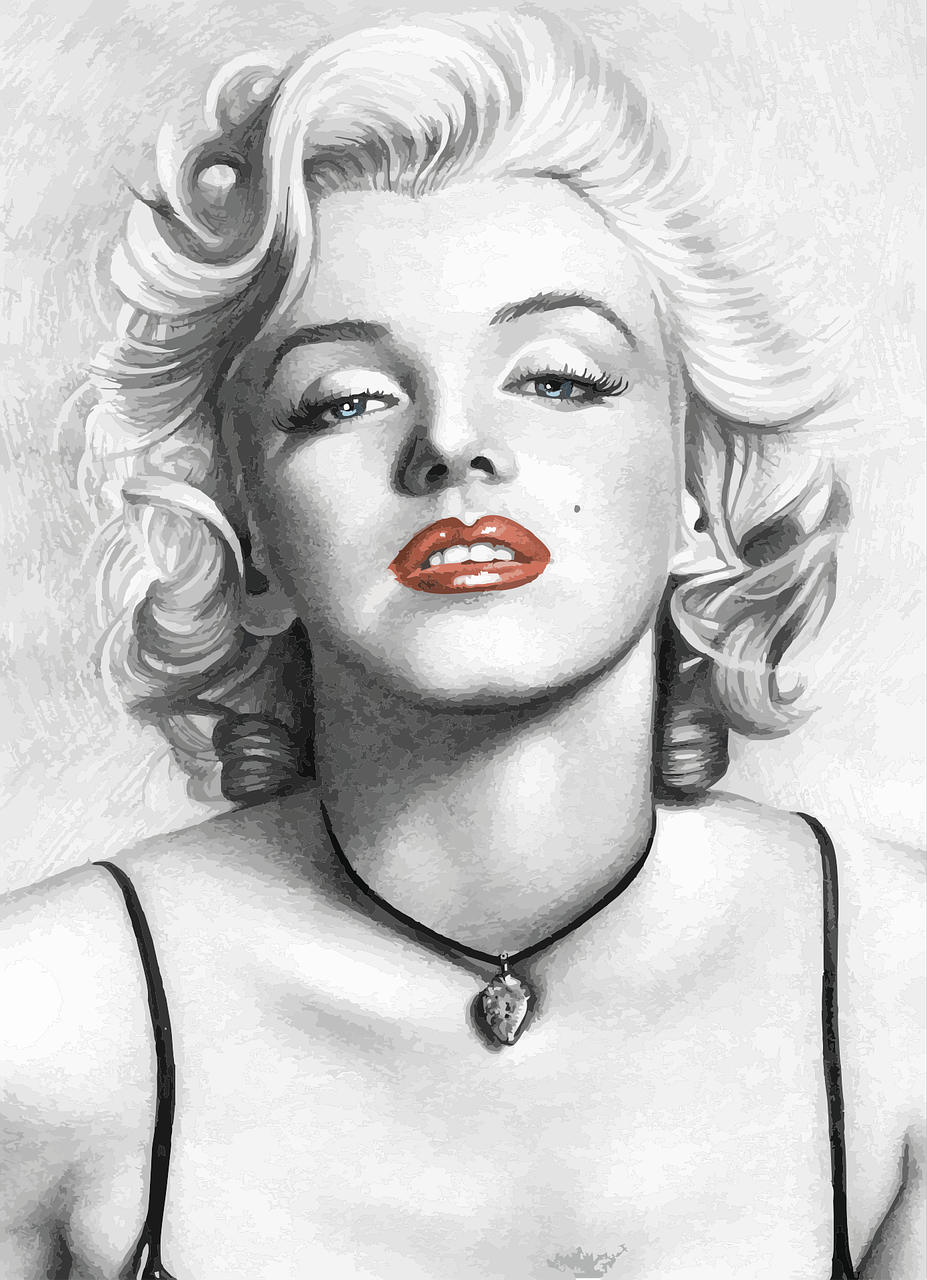Gendern, das Umformen von Sprache um Geschlechtergerechtigkeit auszudrücken, verändert die Texte die wir alltäglich lesen immer mehr. Sind diese Ausdrücke nur ein Ärgernis beim Lesen oder ein Notwendiges Übel auf dem Weg zur Gleichstellung?
Stolperfalle
Neulich saß ich beim Frühstück mit der Zeitung, ein Auge auf der Teetasse, ein Auge auf dem Tablet. Der Artikel, eine mäßig spannende Beziehungskiste, schien mir einfach genug, um nicht mit voller Konzentration lesen zu müssen, und gleichzeitig einige eigene Gedanken spinnen zu können. Aber Pustekuchen. Gleich in der ersten Zeile sprangen mir etliche Sternchen entgegen. Viele Wörter, bei denen eine männliche oder weibliche Deutung möglich war, wurden mittels Stern doppeldeutig – und das sind bei einem Artikel über Beziehungen eine ganze Menge.
Vielleicht hätte ich mich beim Lesen daran gewöhnt, wie an die neue deutsche Rechtschreibung. Leider hat der Autor oder die Autorin in diesem Fall nicht komplett durchgehalten und verwendete eine Mischung aus der Sternchenform, der expliziten Nennung beider Geschlechter und geschlechtsneutralen Formulierungen wie „Liebende“. In diesem Fall erhöhte Abwechslung die Spannung nicht, sondern ließ mich nach der Hälfte entnervt aufgeben.
Etwas hat dieser Text allerdings erreicht: Zum ersten Mal stellte ich mir beim Lesen die Frage, wie sinnvoll das Gendern von Texten wirklich ist. Liegt es an mir? Ist es vielleicht reine Gewohnheit, bin ich so altmodisch sozialisiert, dass es mir schwerfällt, mich auf eine neue Schreibweise einzustellen? Ich würde mich politisch linksliberal verorten, kann dem Feminismus Einiges abgewinnen und bin Neuem gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen. Ich will dem Gendern also noch eine Chance geben, mich zu überzeugen, wenn es doch der Sache dient.
Lesevergnügen
Die häufigsten Texte, in denen auf sprachliche Gleichstellung geachtet wird, sind sicherlich Stellenanzeigen. Sie müssen, schon von Gesetzes wegen, entweder geschlechtsneutral gehalten sein oder beide Geschlechter ansprechen, um einer Diskriminierung bei der Stellenvergabe vorzubeugen. Das ist einleuchtend und kann entweder durch die explizite Nennung beider Geschlechter, beispielsweise Lagerist oder Lageristin, durch die Abkürzung Lagerist/-in oder durch die mittlerweile sehr verbreitete Nennung der männlichen oder geschlechtsneutralen Form und dem Zusatz m/w erreicht werden. Das gilt auch für öffentliche Bekanntmachungen und Ähnliches. Der Spagat, der dabei zwischen guter Absicht und Verständlichkeit versucht wird, gelingt nicht immer. Und ich frage mich, ob sich wirklich mehr Frauen auf die Stelle als Lokführer/-in bewerben, nur weil sie in der Anzeige genannt werden.
Auch viele Journalisten verwenden mittlerweile unterschiedliche Methoden, um geschlechtergerecht zu formulieren. So sollen Frauen in der Gesellschaft sichtbarer werden, Diskriminierung möchte man vermeiden und eine Zukunft der Gleichstellung einläuten. Besonders die Artikel von Online-Magazinen wie „ze.tt“, „bento“ oder „jetzt“, die eine jüngere Zielgruppe als die Stammblätter „Zeit“, „Spiegel“ und „Süddeutsche Zeitung“ ansprechen sollen, fallen auf. Während auf ältere Leserschaft zugeschnittene Artikel kaum gegendert werden, quellen auf jung getrimmte Artikel vor solchen Formulierungen über. Schließlich geht es um die Zukunft.
Theorie und Praxis
Die feministische Forderung, auch das weibliche Geschlecht in Texten sichtbar zu machen, beruht auf der Sapir-Whorf-Hypothese aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Diese besagt im Kern, dass nicht nur die Sprache aus dem Denken hervorgeht, auch das Denken selbst wird durch die Sprache geformt. Lange Zeit war diese linguistische Richtung sehr umstritten, ihre Gegner, darunter viele namhafte Linguisten wie Noam Chomsky, vertraten die Ansicht, dass der Mensch eine angeborene „Grundgrammatik“ besäße, aus der sich dann durch Sozialisation die Sprache herausbildet.
Mittlerweile ist die durchaus charmante Sapir-Whorf-Hypothese zum Thema vieler Studien geworden. Allein der Wikipedia-Artikel zur „Geschlechtergerechten Sprache“ zählt mehrere auf, auch die Reaktion des Publikums zur Verständlichkeit von Texten und zur Akzeptanz in der Bevölkerung ist mehrfach untersucht worden. Wöchentlich erscheinen neue Artikel zum Thema, und je nach Wunsch kann man sich aussuchen, welcher Studie man Glauben schenkt. Etliche dieser Studien nahm ich mir bei meinen Recherchen vor: unter anderem Gabriel et al. 2008, Gygax et. al. 2008, Braun et al. 2007, Vervecken/Hannover 2015. Mir scheint, dass es schwer ist, beim Studiendesign zwischen sprachlichen und soziologischen Gründen für die Resultate zu trennen. Das einzige klare Ergebnis ist, dass die Akzeptanz geschlechtergerechter Sprache insgesamt steigt.
Insbesondere die letzte dieser Studien, deren Pressetext vor zwei Jahren in etlichen Medien erschien, schien mir auf den ersten Blick interessant: hier wurde die Reaktion von Schulkindern auf Berufsbezeichnungen getestet. Für wie erreichbar halten die Kinder, Jungs und Mädchen, Berufe, wenn sie ihnen mit männlichen oder mit weiblichen Berufsbezeichnungen präsentiert werden? Im kurzen Pressetext war der Tenor: endlich sei erwiesen, dass die Nennung beider Geschlechter in Berufsbezeichnungen dazu führte, dass Mädchen eher dazu bereit wären, typisch männliche Berufe zu ergreifen. Weniger Beachtung fand ein weiteres Ergebnis der Studie, das in einem kurzen Satz am Ende des Pressetextes erwähnt wurde: nicht nur, dass Mädchen UND Jungen die Berufe, in denen beide Geschlechter explizit genannt wurden, für erreichbarer hielten als die rein männlich bezeichneten, sie hätten diesen auch eine geringere Bezahlung zugestanden.
Für mich hat dieses Ergebnis auf jeden Fall eine große Bedeutung, und zwar eine eher soziale, als linguistische: Berufe, die Frauen ergreifen, gelten als weniger anspruchsvoll, und verdienen deshalb eine geringere Entlohnung. Dies sehen übrigens beide Geschlechter so. Willkommen, Gender Pay Gap!
Kann also durch das Gendern von Texten eine tatsächliche Gleichstellung beider Geschlechter erreicht werden? Wenn in Texten von IngenieurInnen die Rede ist, lassen sich dann wirklich mehr Frauen zu einem IngenieurInnensstudium verleiten oder werden mehr Männer im Kindergarten arbeiten, wenn man auch von Erziehern spricht? Linguisten wie André Meinunger bezweifeln, dass dies wirklich zu einer Gleichstellung führt, zumal in der deutschen Sprache beispielsweise bei Artikeln sowieso ein weibliches Übergewicht herrscht. Wenn die Faktenlage nicht ganz eindeutig ist, kommt es vielleicht auf einen Versuch an, wie bei der Frauenquoten.
Ist es so einfach?
Trotz dem frommen Wunsch nach Gleichheit zwischen den Geschlechtern erscheint es mir fragwürdig, auf eine explizite Nennung der weiblichen Form zu beharren. In Zeiten, in denen es selbst bei Facebook unzählige Geschlechtsidentitäten zur Auswahl gibt, wirkt es seltsam, plötzlich auf zwei Geschlechter zu reduzieren. Während zuvor in einer Bezeichnung alle Geschlechtsidentitäten subsummiert waren, begrenzt man durch die Nennung zweier Geschlechter wirklich auf zwei. Professoren können männlich, weiblich oder alles dazwischen und darüber hinaus sein, wenn ich Professor/-innen anspreche, scheine ich wesentlich klarer nur zwei Gruppen anzusprechen. Das modernere Professx lasse ich mal als Zungenbrecher stehen. Die Umschreibung „universitäre Lehrkraft“ ist ungenau und umständlich, aber mir auf den ersten Blick sympathischer, weil neutraler.
Ist das vielleicht die Lösung? Wenn wir für alle Bezeichnungen, die zuvor Männlichkeit suggerierten, geschlechtsneutrale Begriffe wie Studierende, Putzkraft oder Müllbeseitigungsfachkraft finden, verlieren wir zwar ein Stück Präzision und Kürze, aber wenn es doch der guten Sache dient, kann es nicht verkehrt sein.
Die Probe aufs Exempel
In der Mathematik ist es üblich, nach einer Rechnung die Probe zu machen, um das Ergebnis zu überprüfen. Hier scheint es ganz einfach, denn nicht alle Sprachen besitzen wie das Deutsche ein grammatisches Geschlecht. Manchmal, wie im Englischen, ist es dabei verloren zugehen, bei etwa der Hälfte aller Sprachen weltweit ist es in der Grammatik nicht angelegt. Sprachen ohne Geschlechter sind etwa die finno-ugrischen Sprachen wie Estnisch, Finnisch und Ungarisch, aber auch Chinesisch, Japanisch und Türkisch. Sogar indogermanische, also mit dem Deutschen verwandte Sprachen wie Persisch und Kurdisch kommen ganz ohne Geschlechter aus.
Nun stellt sich mir ganz banal die Frage: müsste es dort, wo diese Sprachen gesprochen werden, nicht eine wesentlich größere Gleichheit zwischen den Geschlechtern geben, wenn man der feministischen Prämisse glaubt? Ich fürchte, diese Frage könnt Ihr selbst beantworten. Wenn man darüber hinaus bedenkt, dass in Ländern des ehemaligen Ostblocks Frauen in hierzulande männlich besetzten Berufen wesentlich häufiger tätig waren, drängt sich ein neuer Gedanke auf. Die Angleichung der Geschlechter im Alltag und auf dem Arbeitsmarkt könnte einfach viel stärker kulturell und sozial als sprachlich bedingt sein. Dann wären diese sprachlichen Spielereien nicht viel mehr als Augenwischerei, die eine formale Gleichstellung suggeriert in Bereichen, in denen sie faktisch nicht gegeben ist.
Feministische Zukunft
Den Kampf um gerechte Bezahlung, um den Gleichwertigkeit in der Gesellschaft, um die Freiheit unserer Zukunft kann uns Frauen leider keiner abnehmen, auch nicht durch die Nennung unseres Geschlechtes. So lange der gesellschaftliche Konsens, wenn auch nur im Subtext, wie es die schöne Schulkinder-Studie zeigte, ist, dass Berufe, in denen Frauen arbeiten, keine hohe Bezahlung verdienen und leicht und anspruchslos sind, geht der Kampf weiter.
Ich glaube mittlerweile, es wäre besser, wenn eines Tages so viele Ärztinnen, Ingenieurinnen, Anwältinnen und Politikerinnen ihren Berufen nachgehen, dass man bei den Wörtern Arzt, Anwalt, Ingenieur und Politiker automatisch auch an Frauen denkt. Und weil wir keine Rosinenpicker sein wollen, gilt das auch für Schweißer, Kanalarbeiter und Mechaniker. Wenn wir es im Gegenzug schaffen, soziale Berufe, in denen Frauen wesentlich stärker vertreten sind, so aufzuwerten, wie es ihrer gesellschaftstragenden Funktion eigentlich zukommt, haben wir schon gewonnen. Dann wird es auch mehr männliche Erzieher, Altenpfleger und vielleicht sogar Küchenhilfen geben.
Solange wir zulassen, dass unsere Töchter in der Kindheit in eine rosa Plüsch-Prinzessinnen-Wolke gepackt werden und unsere Söhne ausgelacht, wenn sie statt mit dem Fußball mit dem Puppenwagen den Park umrunden, sehe ich da leider schwarz. Solange wir im Alltag statistische Unterschiede zwischen den Geschlechtern stärker betonen als Unterschiede zwischen individuellen Charakteren, wird es schwer. Vielleicht müssen wir das Problem doch an der Wurzel anpacken und unser eigenes Verhalten reflektieren, statt an Symptomen herumzudoktern. Dann sind auch unsere Artikel weiterhin ein literarisches Vergnügen ohne Stolperfallen.
Nachtrag: Nach meiner Recherche für diesen Artikel unterhielt ich mich mit einer Bekannten über das Thema. Sie hat Physik studiert, kommt aus dem Nordosten der Republik und promoviert gerade. Sie fragte mich dann nach meiner Meinung, und ich antwortete darauf wahrheitsgemäß, dass ich noch auf der Suche sei, aber insgesamt der Bevorzugung des Geschlechtsdimorphismus eher skeptisch gegenüberstünde. Sie hielt kurz inne, dann brach es aus ihr heraus: sie empfände es als eine Frechheit, anders als ihre männlichen Kollegen bezeichnet zu werden. Sie hätte das gleiche Studium abgeschlossen, dann verdiente sie auch die gleiche Berufsbezeichnung! Wenn man unbedingt das Geschlecht benennen müsse, könne man ja auch von männlichen oder weiblichen Physikern sprechen. Im Übrigen empfand sie es als große Selbstverständlichkeit, dass sie mehr als ihr Mann verdient.
In dem Moment ging mir auf: Ja, genau so sollte es sein. Wir sollten ebenso selbstverständlich gleich behandelt werden wollen, im Guten wie im Schlechten, wie die Männer, wenn wir es wirklich ernst meinen. Und wenn wir der Ansicht sind, dass wir etwas Besseres verdienen, dann auch dafür einstehen!
Euer Autor Marta Kneip